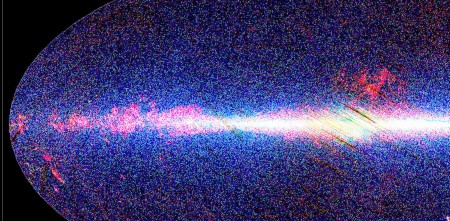Die entscheidende Szene, gesehen von einer Videokamera auf der Oberstufe der H-2A-Rakete und zu sehen in einem spannenden Webcast der japanischen Weltraumbehörde JAXA: 27 Minuten nach dem Start macht sich Akatsuki auf den Weg zur Venus, später folgen auf gleicher Route der Sonnensegler IKAROS und der Funktestsatellit UNITEC-1. Bevor die Oberstufe ein zweites Mal gezündet und so Fluchtgeschwindigkeit aus dem Erdorbit erreicht hatte, waren in demselben bereits drei CubeSats ausgesetzt worden. Diesmal war das Wetter besser als drei Tage zuvor gewesen, und die ganze Startsequenz scheint wie am Schnürchen verlaufen zu sein; die einzelnen Satelliten müssen nun natürlich noch eingehend getestet werden. Akatsuki soll nach der Ankunft Anfang Dezember mindestens zwei Jahre lang im Venusorbit arbeiten, IKAROS mindestens 1/2, vielleicht auch ein Jahr auf heliozentrischer Bahn.
Akatsuki (ausgesprochen „A’katzki“) alias Venus Climate Orbiter (VCO) alias PLANET-C ist gewissermaßen Japans Gegenstück zum Venus Express Europas (und nach japanischer Sichtweise sogar wesentliche Motivation für das ESA-Projekt gewesen, das dank Benutzung von viel vorhandener Hardware nur viel schneller auf die Rampe gekommen war). Während der Venus Express den Planeten auf einer Polarbahn umkreist, soll Akatsuki eine 300 x 80’000 km hohe retrograd um 8° geneigte Äquatorialbahn mit 30 Stunden Periode einnehmen, aus der heraus die um den Planeten rasenden Wolken besser erfasst werden können. Auch soll Akatsuki mit gleich 5 Kameras für UV vis IR sowie per Radiodurchleuchtung mit einem ultrastabilen Oszillator an Bord das ganze Wettergeschehen in seiner kompletten vertikalen Schichtung noch systematischer erfassen – und als erster interplanetarer „Wettersatellit“ (und in direkter Kooperation mit dem Venus Express) das Verständnis der Venusatmosphäre erheblich vertiefen. Wie es überhaupt zu der Superrotation kommt, könnte dabei geklärt werden. Und vielleicht gelingen auch endlich direkte Bilder der mutmaßlichen Venus-Blitze.
IKAROS – Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation of the Sun – soll während des Flugs Richtung Venus nach etwa einem Monat ein 14 x 14 m großes Sonnensegel aus einer nur 7.5 µm dicken Folie aus Polyimiden entfalten, das derzeit noch trickreich um den Satellitenkörper aufgewickelt ist: Dieser wird in Rotation versetzt, so dass sich das 200-m^2-Segel ausbreitet und ohne weitere Mechanik stabilisiert wird. Das wäre schon der erste Erfolg, aber die JAXA will mehr: Durch stellenweise Veränderung der Albedo des Segels und Drehungen des Satelliten durch kleine Düsen ist auch ein wenig Navigation auf der Bahn an der Venus vorbei und um die Sonne möglich. Und Teile des Segels tragen zugleich ultradünne Solarzellen für die Energieversorgung: All das macht IKAROS zum entscheidenen Test für einen solargetriebenen Riesensegler, der in den 2020-ern auf den Weg zum Jupiter und seinen Trojaner-Asteroiden geschickt werden soll. Und weil noch Platz auf dem kleinen IKAROS-Satelliten war, trägt er gleich noch einen Staubdetektor und einen Sensor für kosmische Gamma Ray Bursts. Auch Akatsuki wird übrigens für etwas Bonus-Science genutzt: Seine 2-µm-Kamera wird auf den Weg zur Venus den Zodialkalstaub beobachten.